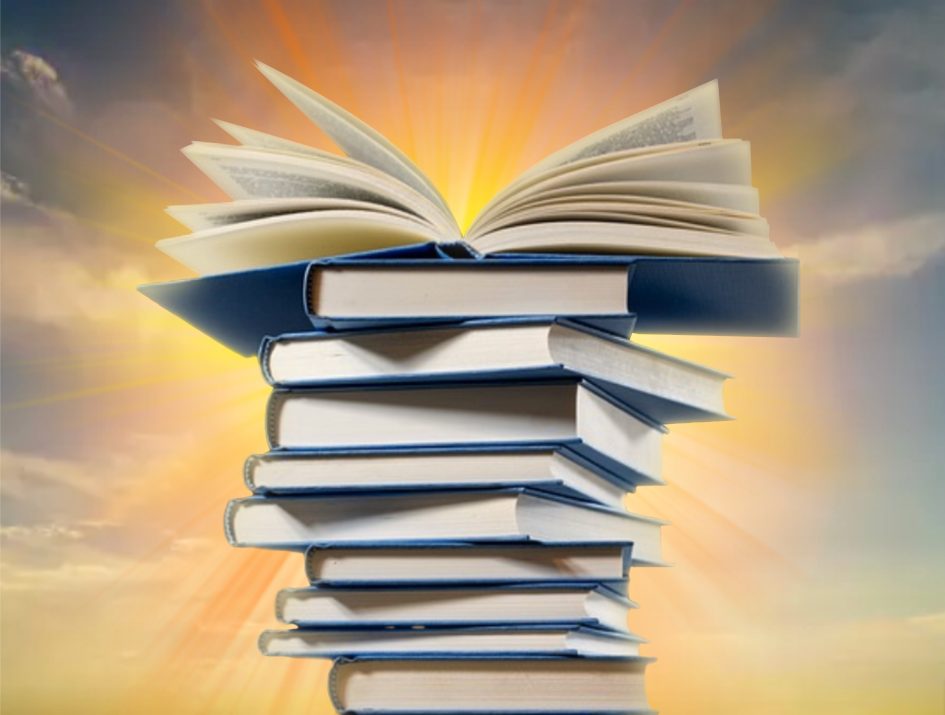
Von Alexander Wendt und Günter Scholdt
Wenn schon Obsoleszenz, dann richtig mit Weltuntergang
Dietrich Brüggemann, ein plötzlich verfemter Autor, liefert in „Materialermüdung“ eine überhaupt nicht heitere, aber stellenweise saukomische Deutschlandbeschreibung
Manchmal beginnt das Schicksal von Büchern schon im Manuskriptstadium. Für Dietrich Brüggemanns Erstlingsroman „Materialermüdung“ gilt das auf jeden Fall. Der Text sollte im Berliner Kanon Verlag erscheinen. Dann kam etwas dazwischen, was sich beispielsweise so erzählen ließe: „Jemand musste Dietrich B. verleumdet haben, denn ohne dass er seiner Meinung nach etwas Böses getan hatte, wurde er von heute auf morgen vom Kulturleben ausgeschlossen.“ Jedenfalls von dem Teil, der sich als helle Seite der Macht versteht. Eine Tat Brüggemanns gab es allerdings. Im April 2021 produzierte der Tatortregisseur zusammen mit einer ganzen Reihe von Schauspielern und anderen Angehörigen des Kulturbetriebs die Videoserie „Allesdichtmachen“, eine satirische Attacke auf die außer Rand und Band geratene staatliche Coronapolitik, die im Kern darin bestand, das öffentliche Leben zur Virusbekämpfung flächendeckend lahmzulegen und den Bürgern selbstverständliche Freiheiten bestenfalls als Belohnung gegen Wohlverhalten zurückzuerstatten. Wer sich die Videos heute anschaut, dem fällt es schwer – auch in Kenntnis dieser bleiernen Zeit –, die orchestrierte politisch-mediale Erregung darüber zu verstehen.
Mittlerweile sprechen sich schließlich selbst Spitzenpolitiker dafür aus, die Corona-Zeit ein bisschen aufzuarbeiten, selbstverständlich mit vorher definierten Fragen und vorausgewählten Diskutanten und keinesfalls als „Blamegame“ (Katrin Göring-Eckardt), also als Aufklärung darüber, wer damals die Verantwortung für konkrete Freiheitseinschränkungen trug, die überwiegend gegen die Virusausbreitung so viel nützten wie kalte Umschläge. Aber trotz all dieser Einschränkungsklauseln und neuen Lenkungsversuche gestehen mittlerweile sogar die Göring-Eckardts zu, dass es an den Coronamaßnahmen hier und da möglicherweise das eine oder andere zu kritisieren gebe. Aus heutiger Sicht, wie sie dann nie zu betonen vergessen. Aus dieser berühmten heutigen Sicht wirken die Allesdichtmachen-Videos geradezu harmlos.
Damals, im Frühjahr 2021, starteten Journalisten und Funktionäre allerdings eine Art neosozialistischen Wettbewerb um die schärfste Verdammung der Aktion, die Videogruppe landete vor einem medialen Standgericht, ein SPD-Politiker forderte, dem beteiligten Schauspieler Jan Josef Liefers die Rolle des Tatortpathologen zu entziehen, der Tagesspiegel, ganz weit vorn, log und schwurbelte einen gesellschaftsfeindlichen bis rechtsradikalen Hintergrund zusammen, vor dem sich plötzlich auch der noch nicht einmal konservative Brüggemann wiederfand. Dort hieß es über den Regisseur, er versuche mit dieser Aktion, „die Grenze zwischen Wahr und Falsch zu verwischen“.
Die lückenlose Bewachung dieses Schutzwalls, das erfuhr Brüggemann spätestens in diesem Moment, fällt in Deutschland nun einmal in die Kompetenz der wohlmeinenden Medienschaffenden. Nach der öffentlichen Anprangerung nahmen die Dinge ihren Lauf, ohne dass es dafür irgendeine formale Anweisung brauchte. Der erwähnte Berliner Kanon Verlag kündigte ihm den Autorenvertrag, das Hamburger Musiklabel „Grand Hotel van Cleef“ den Vertrag mit Brüggemanns Band, die den schönen Namen „Shitstorm“ trägt. Seine speziell für Kinderbücher zuständige Literaturagentin lehnte es ab, weiter mit ihm zu arbeiten. Kurzum, das Kulturkombinat der widerständigen Couragepreisträger und Resolutionsunterschreiber schlug die Hacken zusammen und parierte. Nach einer langen Reihe von Ablehnungen landete das „Materialermüdung“-Manuskript schließlich bei der winzigen „Edition W“ in Frankfurt. Als es dann erschien, stellte die Süddeutsche gleich in der Überschrift ihrer Besprechung ein Warnschild auf: „Der Filmemacher und #AllesDichtMachen-Unruhestifter Dietrich Brüggemann hat einen bösen Roman geschrieben: Wie viel Geschwurbel steckt in ‚Materialermüdung‘?“
Was steckt also in diesem Buch, das eine längere Entstehungsgeschichte mitbringt? Es handelt sich, soviel vorab, weder um einen Corona-Roman noch überhaupt um einen vordergründig politischen Text. Ohne die Markierung, die der Delinquent seit 2021 auf dem Rücken trägt, würde ein süddeutscher Redakteur bei seiner Besprechung vermutlich sogar ohne rhetorische Kneifzange auskommen.
Für den Leser stellt es sich als Glück heraus, dass der Autor nicht abrechnet, sondern als teilnehmender, aber immer distanzierter Beobachter einen Roman vorlegt, der überwiegend im Berliner Hochbedeutungsmilieu spielt. Bei einem Autor wie ihm entsteht da die Komik fast von selbst. Dietrich Brüggemann, geboren 1970 in München, zeigt sich in seinem Debüt als meisterhafter Beschreiber von Mikroszenen, die sich unter nie so ganz erwachsenen Großstadtbewohnern im Dreieck von Werbung, Medien und Kultur abspielen; er beweist sich als Spezialist für den Slang dieser Gesellschaftsschicht, für das, was Karl Kraus einmal Tonfallstricke nannte.
Der Roman kommt mit drei Hauptfiguren aus: Jacob, seiner Freundin Maya und dem gemeinsamen Freund Moses. Zu Beginn und auf gewisse Weise zum Schluss tritt auch Jacobs Vater auf, eine harmlos durchgeknallte Figur, eingekapselt in eine Welt, in der die Bilderberger, diverse andere Dunkelmännerstiftungen und der Teilchenbeschleuniger CERN tragende Rollen spielen. Mit diesem Senior führt Brüggemann übrigens einen echten Verschwörungstheoretiker in die neuere deutsche Literatur ein.
Seiner als road novel angelegten Entwicklung der drei Freunde schiebt der Autor eine Bedeutungsebene unter, mit der er alle Szenen und Dialoge zusammenhält, nämlich die Bibel. Der Roman beginnt mit dem ersten Satz der Schöpfungsgeschichte (in diesem Fall allerdings für einen Werbetext), es geht weiter mit der Vertreibung aus dem Paradies – dem Garten von Jacobs Vater, wo Jacob und Maya Quartier nehmen und sich verbotenerweise am einzigen Apfelbäumchen vergreifen. Dort ist, wie der Sohn vor seinem Rauswurf richtigerweise feststellt, sowieso der Wurm drin. Zum Finale behält der alte Verschwörungstheoretiker Recht, die Schöpfung läuft rückwärts, die Welt, vorher schon recht locker zusammengefügt, weil es speziell im mittigen Berlin und auch drumherum kaum wirklich feste Verhältnisse gibt, weder privat noch beruflich, fällt wortwörtlich auseinander. Zwischendurch kippt der Fernsehturm um. Warum und wie genau, das muss der Leser herausfinden.
In diesem Erzählrahmen also bewegen sich drei postpostmoderne Helden, wie der Leser sie so ähnlich auch von Michel Houellebecq kennt, Figuren, die gewohnheitsmäßig alles, was sie tun, in Echtzeit problematisieren, obwohl ihnen der Gedanke kommt, dass es ihnen ohne diese Selbstanalysemühle vermutlich besser ginge. Über Moses heißt es: „Moses trank über eine halbe Stunde hinweg sein alkoholfreies Bier aus, bestellte dann ein zweites und dachte nach, ohne dass viel herauskam.“ Als Jacob sich – noch im Paradiesgarten – mit Maya vergnügt, läuft bei ihm sofort die innere Tonspur mit: „Sex in der Hängematte erwies sich als umständlich, aber interessant. Umständlich, aber interessant, dachte Jacob vor sich hin, das beschreibt das Zusammensein mit Maya generell ganz gut, und dann dachte er: Schweife ich schon wieder ab? Bin ich überhaupt bei der Sache?“ Das sind Brüggemanns Charaktere nie. Sie würden zurückfragen: Welche Sache denn?
Er beschreibt aus profunder Kenntnis eine tatsächlich gesellschaftsprägende Schicht, deren Angehörige drei Dinge nicht glauben: Erstens, dass das, worüber sie reden, womöglich gar keine Bedeutung für andere hat und noch nicht einmal für sie selbst. Zweitens, dass etwas – egal ob ein anderer Mensch oder ein Anliegen – mehr sein könnte als ein aktuelles Projekt. Und drittens, dass sie jemals alt werden könnten.
Maya arbeitet in einem vierköpfigen Theaterkollektiv namens IMPENETRANCA#62C, was bedeutet, dass sie an einem Stück über Obsoleszenz bastelt, also Überflüssigkeit. Das klingt wie eine Parodie auf den Haupterwerbszweig zwischen Berlin Mitte bis Friedrichshain, nämlich die subventionierte Selbst- und Persönlichkeitssuche von Anfangdreißigern, die meist in der Feststellung endet, dass so etwas wie Persönlichkeit gar nicht ihr Ding ist. Aber was heißt schon: Parodie? Brüggemann verdichtet eher, als dass er übertreibt. Und bei allem Spott denunziert er keine seiner Figuren. Im Gegenteil, er behandelt sie mit distanzierter Liebe, aber eben dennoch: Liebe.
Viele der kleinen Szenen in „Materialermüdung“ erinnern an die Lakonie Wolfgang Herrndorfs: „Ein Anfangdreißiger mit Lukas-Podolski-Blick trug zwei Cocktails zu einer blonden Frau, die ebenfalls aussah wie Lukas Podolski.“ Die ewigen Analysebegriffe der urbanen Klasse dreht der Autor mit leichter Berührung auf die komische Seite, etwa, wenn Maya sich ihre Gedanken über eine Nebenfigur macht: „Sie überlegte, ob das toxische Männlichkeit war, aber andererseits erinnerte Julian sie in solchen Momenten eher an ihre beste Freundin aus der Grundschule, vielleicht war es also toxische Weiblichkeit.“ Apropos Herrndorf: Der hielt es für ein Wesensmerkmal von Literatur, dass die Charaktere größtenteils aneinander vorbeireden. Gingen sie im wechselseitigen Verständnis auf, meinte er, dann handle es sich wahrscheinlich um ein Sachbuch.
Die Handlung des Romans spielt vor Corona. Es blitzt trotzdem kurz auf, was Brüggemann auch mit seiner Aktion „Allesdichtmachen“ vorführte: Die Bereitschaft von Leuten, die sich für höchst individuell halten, sich Vorschriften zu unterwerfen, und zwar nur deshalb, weil es auch andere tun. An einer Stelle weist eine Frau Moses zurecht, weil der im Stau auf der Autobahn in der Rettungsgasse steht, durch die allerdings kein Rettungswagen kommt. „Darum geht es gar nicht“, erklärt ihm die Fahrerin, als er sie darauf hinweist, dass er niemanden blockiert: „Das ist die Regel, und an die müssen auch Sie sich halten.“ Damit beantwortet sie, worum es in Wirklichkeit geht, nämlich um das Prinzip. Und das besteht darin, dass Bürger ganz ohne Anweisungen gegenüber anderen Bürgern Polizei spielen. Zwischen diesen beiden Phänomenen siedelt Brüggemann sein Deutschlandbild an: neurotisch im Kleinen, ansonsten gleichgültig, da alles andere sich so flüchtig-fluid wie Mayas Theatergruppe verhält.
Eine Reise durch Deutschland als Zustandsbericht, das gab es schon mit Christian Krachts „Faserland“ von 1995. Nach knapp dreißig Jahren ist es Zeit für eine neue Tour. Brüggemanns Kamerafahrt liefert ein tiefenscharfes, überhaupt nicht heiteres, dafür aber oft saukomisches Bild dieser eigenartigen Gegend. Und das, obwohl er sich auf ein ganz bestimmtes Gesellschaftssegment beschränkt. Wo, fragt der Leser möglicherweise, bleiben die Normalos, die keine Theaterstücke über Obsoleszenz herstellen? Der Autor selbst vertritt die relative Normalität. Sonst würde er anders auf seine Figuren und ihre Sprache schauen. Und er hätte anderenfalls die „Allesdichtmachen“-Serie nicht produziert.
Übrigens kommt „schwurbel, schwurbel“ zweimal vor, und das auch noch direkt hintereinander (Seite 98). Was die Frage der Süddeutschen vollumfänglich beantwortet.
Dietrich Brüggemann, „Materialermüdung“, Edition W, 480 Seiten, 25 Euro
Erst das Licht der Vergänglichkeit macht das Leben süß
In „Die Kunst des Lebens, die Kunst des Sterbens“ schreibt Lorenz Jäger mit Leichtigkeit über letzte Dinge – und ermutigt seine Leser, das Alter als Zeit der Ernte zu schätzen
Verfolgt Lorenz Jäger mit seinem Buch „Die Kunst des Lebens, die Kunst des Sterbens“ ein Ziel? Nein, nicht in dem Sinn, dass er bei seinen Lesern einen Bewusstseinswandel erreichen oder in eine gesellschaftliche Debatte eingreifen will. Das macht seinen Text schön und frei. Seine Perspektive auf die ersten und letzten Dinge findet sich in einer Passage über den greisen Goethe, der vor dem jüngeren Wilhelm von Humboldt die Idee der Steigerung ausbreitet, die auch im hohen Alter noch möglich sei. „Nicht im Sinne von weiterer Expansion war das ‚Steigern‘ gemeint“, heißt es dort bei Jäger, „sondern als Verdichtung dessen, was ‚ist und geblieben ist‘. Weisheit ist eine Form der Einsicht, die nicht mehr auf den Erfolg als ihr Ziel gerichtet ist.“
Lorenz Jäger, Jahrgang 1951, der Soziologie in Frankfurt studierte, bevor dort, wie er später sagte, der Geist des marxistischen Dogmatismus einzog, der an der Hokkaido University in Sapporo lehrte und von 1997 bis 2015 das Ressort Geisteswissenschaften der FAZ prägte, wendet sich in „Die Kunst des Lebens, die Kunst des Sterbens“ der Spannung zu, die sich in der Literatur findet, in der Philosophie, aber eben auch in jeder einzelnen Biografie: Ursprung und Ende, Liebe und Tod, Jugend und Alter, Todessehnsucht und Unsterblichkeitswunsch. Spiegelt sich das eine im anderen, dann ergibt sich für ihn das Bild der ganzen, nun einmal zeitlich begrenzten und nur sehr bedingt lenkbaren Existenz: „Der Kontrast zwischen dem höchsten Lebensglück und der Vernichtung treibt die Kontur von beidem erst heraus.“
Auf seinen 272 Seiten durchstreift Jäger die Ideenlandschaft vom Gilgamesch-Epos und Homer (der vom „süßen Leben“ spricht und damit nicht Luxus meint, sondern die Lebendigkeit selbst) über die griechischen Philosophen und die Bibel bis zu Marcel Proust, Franz Kafka und Uwe Johnson. Natürlich kommen auch Theodor W. Adorno und Walter Benjamin als Vertreter der Moderne zu Wort. Zu beiden hatte Jäger eine Biografie vorgelegt.
Aus dem literarischen und philosophischen Fundus jener „dreitausend Jahre“, die, wie Goethe einmal meinte, jeder ernsthaft geistige Mensch zu überblicken in der Lage sein sollte, entwickelt Jäger seine Schlussfolgerungen zu Leben und Tod oder vielmehr: Er wickelt sie aus, er nimmt ihre Hüllen ab. Das Sprachbild vom Auswickeln der Gedanken, das er bei Friedrich Wilhelm Joseph Schelling findet, beschreibt auch die Methode des Autors ganz gut. Vor allem aber handelt es sich um Jägers ganz eigene intellektuelle Erfahrungswelt, die er in 19 kurzen Kapiteln vorführt. Er beschreibt und zitiert, was ihn geistig angezogen hat, ihn immer noch anzieht, und was zu durchdringen ihm Freude macht. Und diese Freude und Zugewandtheit durchzieht den Text, der nie ins Zynische oder Bittere kippt. Sein Buch ähnelt einem Korridor, in dem sich dutzende Türen in seitwärts gelegene Räume öffnen und das Beste zeigen, was die (bei ihm überwiegend europäische) Geistesgeschichte bietet. Wer, angeregt durch Jägers Führung, nur einen Teil davon lesen will, verfügt über ein schönes Programm für die nächsten Jahre.
Wir bewegen uns allerdings nicht durch ein Privatmuseum mit isolierten Schaustücken, wobei das bei diesem Autor allein schon ein Vergnügen wäre. Er zeigt eben nicht nur seine einzelnen Beispiele aus Literatur und Philosophie, sondern auch die Entwicklungen von Gedanken über die Epochen, etwa zur Akzeptanz von Alter und Tod. Bei der Gelassenheit eines Sokrates, der meinte, der Tod berühre ihn nicht und eigentlich überhaupt keinen Menschen; dort, wo das Leben sei, sei er nicht, und dort, wo er sich ausbreite, sei kein Leben mehr, blieb es bekanntlich nicht. Dieser Trost büßte seine ohnehin etwas zweifelhafte Wirksamkeit in dem Maße ein, wie die Moderne vorankam und mit ihr die Ernüchterung des Menschen, nicht mehr im Zentrum der kosmischen Schöpfung zu stehen. Auch das Altersgebrechen galt nun nicht mehr als Teil des Lebens, der klaglos zu tragen war, sondern als Kränkung. Jäger stellt dafür die Ausführungen des noch relativ jungen und gesunden Michel de Montaigne über den Tod, die sich noch an der Gelassenheit antiker Denker orientiert, dem alten gegenüber, der einen ganz anderen Ton anschlägt: „Ich bin dahin gekommen, wie über eine unerhörte Gnade zu frohlocken, wenn mich einmal nichts plagt.“ Über sein früheres Werk meint er: „Seitdem bin ich um ein gutes Bündel Jahre älter geworden […]. Es wäre schön, alt zu werden, wenn wir nur je älter, je besser würden. So aber ist es der torkelnde, schwindlige, unstete Gang eines Betrunkenen, oder gleicht den Binsen, die der Wind hin und her weht, wie er will.“
Inmitten der anverwandelten Texte schreibt Jäger natürlich auch aus seinem ganz eigenen Blickwinkel über das Altern. Und allein diese Abschnitte machen das Buch zum geeigneten Geschenk für alle, die es mit dem Älter- und Altwerden aufnehmen wollen. „Die falscheste Idee“, findet er, „wäre es, zu glauben, nach dem fünfzigsten Geburtstag käme keine neue Erfahrung, keine neue Idee mehr. Alles andere als Erstarrung ist aber die Wahrheit. Genaues kann man nicht prognostizieren, nur dass das Leben – vielleicht in einem letzten großen Aufbäumen gegen die Festgelegtheiten – noch einmal in Fluss kommen will. Oft hat man in dieser Lebensphase seine Erfahrungen so ziemlich arrondiert und wiegt sich in der Sicherheit, dass Neues nicht mehr kommen werde – oder doch nur von den schwachen Nachzüglern der eigenen Jugend. Der sichere Griff in die Gegenwart wird zu einer eher unwahrscheinlichen Leistung, und umso höher ist sie zu veranschlagen.“
Für sich buchstabiert er das aus, was Schopenhauer einmal mit seinem Bonmot hinwarf, bis fünfzig sei das Leben Text, danach Kommentar: „Altern heißt: die Resultate dieser Gestaltungsversuche ins eigene Selbstbild aufnehmen. Die Welt sickert ganz ins Subjekt ein, an die Stelle des adoleszenten Radikalismus tritt auf natürliche Weise ein gewisser Konservativismus, weil man an der Weltgestalt, wie sie jetzt ist, durchaus aktiv beteiligt war, sicher mit den ganz eigenen Tönungen, die aus der langen Erfahrung mit der Welt kommen. Wenn die sechzig überschritten sind, löst sich der Geist von den Kämpfen dieser Gegenwart und steigt in die Tiefe der Seele hinab.“ Hoffentlich, sagen sich vor allem jüngere und mittelalte Leser. Von Bette Davis, die es wirklich wissen musste, stammt der Satz: „Getting old ain‘t for sissies“. Wer hätte auf diesem Weg keinen Zuspruch nötig?
Auch in Jägers Behandlung des Unsterblichkeitswunschs lässt die Kontur das Gegenteil deutlicher hervortreten – die Begrenztheit des Lebens. Er referiert den Teil aus Swifts „Gullivers Reisen“, in dem es den Helden auf die Insel Luggnagg verschlägt. Angehörige einer besonderen Insulanergruppe, Struldbruggs genannt, sterben tatsächlich nie, wie Gulliver erfährt. „Glückliches Volk!“ ruft der Erzähler, „wo jedes im Mutterschoß heranwachsende Kind die Aussicht auf Unsterblichkeit hat.“ Um sich belehren zu lassen, dass die Struldbruggs zu den Unglücklichsten gehören. Denn leider fallen diese Wesen schon mit dreißig Jahren in chronischen Trübsinn, mit achtzig kommen auch für sie die sämtlichen Altersleiden, denn sie verfügen nun einmal nicht über den Status von Göttern. Sie altern wie Normalmenschen, ihr spezielles Schicksal betrügt sie nur um den Tod. Jenseits der neunzig verlieren sie ihr Gedächtnis und spätestens mit zweihundert verstehen sie ihre Mitmenschen nicht mehr. „Niemals“, sagt Gulliver, als er einigen von ihnen tatsächlich begegnet, „hat mich etwas mit tieferem Grauen erfüllt als der Anblick dieser Geschöpfe.“
Aber wandelt sich diese Ansicht nicht gerade? Die Idee des ewigen Lebens, beziehungsweise, wie es heute heißt, longevity, kommt gegenwärtig nicht mehr aus der antiken Idee der Seelenwanderung wie bei Empedokles, auch nicht aus dem Gedanken des transzendenten ewigen Lebens der Religion, sondern von der technischen Seite. Dazu zitiert Jäger aus dem Buch des Philosophen Ingemar Patrick Linden von 2022, „The case against death“, in dem Linden argumentiert, gerade weil der christliche Glaube an ein Leben nach dem Tod schwinde, gewinne der Gedanke an Boden, sich das dauerhafte Leben eben anderweitig zu verschaffen. Schließlich bietet die nähere Zukunft demnächst angeblich eine revolutionäre Möglichkeit dafür, nämlich die technische Speicherung des Gehirninhalts. Was aber auch bedeuten würde: eine statische Existenz ohne lebendiges Ich. „Nehmen wir einmal an, es gelänge, das komplette ‚Bewusstsein‘ auf einem anderen Datenträger zu speichern. Es wäre dann zwar dort, aber niemand hätte etwas davon, auch ‚ich‘ nicht, dessen ‚Inhalt‘ dort lagert, denn das ‚Bin‘ kann nicht mit eingelagert werden“, hält Jäger dagegen: „Dort, im Datenträger, wäre nur eine Anhäufung vorhandener Informationen. Das ‚Ich bin‘ liegt auf einer ganz anderen Ebene.“
Er hält ein Plädoyer für die Begrenzung, deren Überschreitung keinen Gewinn, sondern einen Verlust mit sich bringen würde: „Erst im Licht der Vergänglichkeit erhalten Handlungen Sinn und Bedeutung – wenn sie den Aspekt des Einmaligen, Unwiederholbaren, Risikobehafteten besitzen. Dieser Sinn kann als Triumph erlebt werden oder als Scham, als Wehmut, Trauer oder unverdientes Glück – nur durch diesen Klang wird das, was wir tun und erleben, zur Erfahrung. Erst in Zusammenhängen der Vergänglichkeit erhalten Entscheidungen überhaupt Gewicht, werden Augenblicke dramatisch oder kostbar.“
Die Antwort auf diese Frage steht auch schon ganz vorn in „Die Kunst des Lebens, die Kunst des Sterbens“, und zwar als Eingangszitat von Emily Dickinson: „That it will never come again is what makes life so sweet.“ Ihr Satz gehört zu den aus sich heraus wahren Worten. Und davon finden sich bei Lorenz Jäger viele. Auch am Ende: „Wo es um letzte Worte geht, endet das Reich der Phrase.“
Lorenz Jäger, „Die Kunst des Lebens, die Kunst des Sterbens“, Rowohlt Berlin, 272 Seiten, 25 Euro
Die Liebe zum Fußball in Zeiten der Postdemokratie
Günter Scholdt beschreibt in „Fußball war unser Leben“, wie die Kommerzialisierung und vor allem die Politisierung das schöne Spiel immer fester in den Griff nehmen, an dem es womöglich irgendwann stirbt. Als Bonus folgt ein Text von Scholdt exklusiv für Publico
Gleich auf den ersten Seiten von „Fußball war unser Leben“ zitiert Autor Günter Scholdt den früheren Manager des FC Liverpool, Bill Shankly: „Manche halten Fußball für eine Sache von Leben und Tod. Ich versichere Ihnen, er ist bei weitem wichtiger.“ Der Satz führt direkt zum Untertitel von Scholdts Buch: „Wie Kommerz und Politik die schönste Nebensache der Welt fast zerstörten“. Denn die Fankultur rund um die Clubs und die jeweilige Nationalmannschaft besitzt einen Zauber, der sich nicht künstlich herstellen lässt. Fußball mit allem Drumherum gehört zu den wenigen gesellschaftlichen Ereignissen mit einer Ausstrahlung auf Massen. Spiele sind (immer noch) Feste. Hier finden Milieus zusammen, die einander sonst kaum begegnen. Kein politisch-medialer Apparat braucht diese Anziehungskraft erst zu beschwören, keine Organisation während eines Turniers die Ansteckfähnchen für Autos zu verteilen. Für den Fußball müssen, um es in der politpaternalistischen Fachsprache zu sagen, die Leute nicht erst von irgendjemandem abgeholt werden. Das macht den Wunsch verständlich, die Strahlkraft dieses Sports auf weniger populäre Interessen zu lenken. Das gilt natürlich für Geschäftsinteressen, aber mehr und mehr auch für das Bedürfnis von Politik und politiknahen Organisationen, dem ursprünglich von unten kommenden Spiel Botschaften von oben aufzudrücken.
Dass sich der Fußball bestens als kommerzielle Werbeplattform eignet und mittlerweile ein Geschäftsfeld mit Milliardenumsatz darstellt, nehmen heute viele Fans hin, manche widerwillig, jüngere mittlerweile meist aus Gewohnheit. Scholdt beschreibt als kundiger Sporthistoriker den langen Weg vom Beginn der Bundesliga, als das Einheitsgehalt dort bei monatlichen 1250 Mark plus Prämien lag, bis zu Sandro Wagner, der 2016 in einem Interview meinte, eigentlich sei ein Bayern-Profi mit 12 Millionen Euro im Jahr eher unterbezahlt. Diese Entwicklung schildert er nicht als Ankläger, sondern eher als Chronist; er verweist darauf, dass europäische Spitzenklubs noch ganz andere Ablösesummen verlangen und Umsätze verbuchen als die Mannschaften in Deutschland. Und dass es in anderen Sportarten, etwa beim Basketball und Football der USA, um Summen geht, die den gesamten Jahresumsatz aller europäischen Fußballclubs von etwa 30 Milliarden Euro weit übersteigen. Sein Fazit lautet: „Nicht der Sporthund wackelt mit dem Geschäftsschwanz, sondern umgekehrt.“
Sehr viel destruktiver als der Kommerz, so Scholdts These, wirke allerdings die Transformation der Fußball- in eine Propagandaarena. Das Geld habe immerhin auch zu einer enormen Professionalisierung des Sports beigetragen. Die Aufladung mit wohlgesinnten Botschaften zerstöre dagegen endgültig den Rest des Volksvergnügens. Unter der Überschrift „Fußball als Teil der Postdemokratie“ nimmt er die Fiktion des Profisportlers als Überbringer von Botschaften und Zeichensetzer für die Massen gründlich auseinander. Denn es treten eben nicht Bürger mit ganz besonderen Fähigkeiten vor die Öffentlichkeit, die ihre Position nutzen, um frei mitzuteilen, was ihnen gerade durch den Kopf schwirrt. „Ohnehin beschränkt sich die Lizenz, politisch zu wirken, auf Vorgegebenes“, meint der Autor: „Sollten prominente Sportler tatsächlich einmal abseits vom Mainstream urteilen, statt im Kollektiv nach der Pfeife der Einbläser zu tanzen, kämen sie umgehend nicht mehr zu Wort.“ Davon legt der Fall des Noch-Bayern-Spielers Joshua Kimmich Zeugnis ab, auf den Politiker und Medien von Bild bis hin zur FAZ 2021 eine hysterische Treibjagd veranstalteten, als er von seinem guten Recht Gebrauch machte, sich nicht gegen Corona impfen zu lassen.
Die Vergatterung der Sportler zum öffentlichen Türeinrennen, das natürlich nur in eine vorhersehbare Richtung erfolgen soll – und das nicht nur bei Kickern – kommentiert Scholdt mit mildem Spott, etwa, wenn er die Überschrift einer dpa-Meldung von 2022 zitiert: „Olympia-Team ohne ‚Maulkorb‘.“ Sie bezog sich auf die ausdrückliche Erlaubnis für die deutschen Athleten, in China die chinesische Menschenrechtslage kritisch zu kommentieren. „Wie schön, das zu hören“, schreibt Scholdt: „Auch DDR-Sportler durften sich übrigens kritisch über den Kapitalismus äußern.“
er Verfasser macht nicht den Fehler zu behaupten, früher wäre im Sport alles besser gewesen. „War es nicht“, stellt er fest: Den populären Sog von Sport und speziell Fußball machten sich auch schon vor Jahrzehnten nicht nur Unternehmen, sondern auch Politiker zu nutze. Allerdings, so sein Fazit, herrsche heute besonders auf dem Feld der Politisierung ein ganz anderer, nämlich höherer und für den ursprünglichen Geist des schönen Spiels womöglich tödlicher Druck: „Damals steckte den meisten Verantwortlichen noch die Erfahrung zweier Diktaturen in den Knochen. Unsere aktuelle Funktionärsgeneration ging jedoch offenbar jedes Gespür dafür verloren, dass der Staat sich (jenseits des berechtigten Anliegens, die Volksgesundheit durch Breitensport zu fördern) zurückhalten möge.“
Günter Scholdt, Jahrgang 1946, Germanist, Historiker und bis 2011 Leiter des Literaturarchivs Saar-Lor-Lux-Elsass, betreibt mit „Fußball war unser Leben“ nicht nur eine Erforschung der Sport- , sondern auch der Mentalitätsgeschichte, er zeichnet das Bild einer Gesellschaft, in der an Stelle der Aushandlung von Interessen und Ansichten mehr und mehr die Meinungsführung durch eine Elite tritt, er behandelt in seinen Kapiteln die Verwandlung des Regenbogens von einem Symbol der Bürgerrechtsbewegung in eine institutionelle Machtgeste und befasst sich mit dem Frauenfußball, der eben nicht organisch von unten wächst, sondern wie ein neues Produkt seine Markteinführung erlebt. Das tut er mit profundem Wissen, aber ohne Eifer und mit gezügeltem Zorn. Sein Stil macht sein Buch zum Gewinn auch für Leser, bei denen sich Fußball und Leben nicht ganz so stark überschneiden.
Günter Scholdt, „
Und speziell für Publico geht es noch in die Verlängerung: mit einem Scholdt-Text über die Entscheidung, den Wettbewerbsgedanken aus dem Kinder- und Jugendfußball zu entfernen. Auch diese Idee reicht weit über den Sport hinaus.
„Alles für FUNiño!“
Von Günter Scholdt
Deutsche Fußballfans jauchzt und frohlockt: Die sportpädagogische Wunderwaffe ist da. Sie nennt sich FUNiño, was wie El Niño klingt, aber stattdessen ein Segen ist. Seit 2024 für alle vom DFB Ge(nas)führten bis zur E-Jugend verbindlich, verheißt sie uns eine goldene Fußballzukunft. Gespielt wird mit wenigen Akteuren auf kleineren Plätzen mit vier Toren. Tabellen sind out. Helikoptereltern können aufatmen. Denn es fließen keine Kindertränen mehr bei Niederlagen in peinlicher Höhe. Nach drei Toren Vorsprung gibt’s Verstärkung vom Gegner. Vorbei ist die Seelenfolter klarer Unterlegenheit in einer archaisch-rückständigen Fußballwelt.
„Mehr Spielfreude und Erfolgserlebnisse, weniger Leistungsdruck, mehr Spielzeit für alle Kinder“ versprechen die DFB-Propagandisten. Vergleichbare Spaß- und Gleichheits-Schalmeien kennen wir aus Diskursen über Gesamtschulen und niveaumäßig verkommene Gymnasien. Auch die Bundesjugendspiele schaffte man bekanntlich ab, da sie Untalentierten nicht behagten. An einer deutschen Ausbildungsschule banden engagierte Pädagog(inn)en Jungen beim gemeinsamen Fußball die Arme auf den Rücken, „weil die Mädchen sonst nicht gewinnen können“.
Nun gibt es im Jugendfußball fraglos ein Alter, in dem körperliche Entwicklungsunterschiede zuweilen geradezu erdrücken und selbst begabten Technikern wenig Chancen lassen. Hier schlägt die Stunde von Trainern mit Fingerspitzengefühl, die nicht ausschließlich auf kurzfristigen Erfolg setzen, was Frustrierte aus den Clubs vertreibt. Doch solch drastische Differenzen betreffen vor allem die C-Jugend. Und für die kommt FUNiño ja nicht mehr in Betracht. Auch sei hier nicht halsstarrig jegliche Neuerung verworfen. Schon vor vier Jahrzehnten übte ein kreativer Trainer unserer Herrenmannschaft zuweilen das Spiel mit vier Toren, um schnelles Umschalten zu schulen. Und besonders bei den Kleinen empfehlen sich immer mal wieder einfallsreiche Alternativen zur Norm, um den spezifischen personellen Bedingungen der jeweiligen Vereine besser gerecht zu werden oder Stimmung und Spielintelligenz zu verbessern. Doch muss alles gleich, ausschließlich und deutschlandweit verordnet werden? Und wollen das tatsächlich die Kinder mit großer Mehrheit?
Glaubt man den Fortschritts-Bewegten unter Sport- und Erziehungswissenschaftlern, ist das so. Allerdings misstraue ich deren Resultaten inzwischen ebenso wie einst Churchill Statistiken, die er „nicht selbst gefälscht“ habe. Es gibt gewiss Kinder, die sich beim Toreschießen ohne Keeper wohler fühlen und sich freuen, öfter am Ball zu sein. Andere aber bevorzugen – zumindest als Höhepunkt der Woche – Wettbewerb „wie die Großen“ in einer „echten“ Mannschaft, mit stärkeren Widerständen und Risiken. Schon Vier- bis Fünfjährige fordern ihre größeren Geschwister beim Lauf um den Häuserblock heraus. Und wer vom Fußball wegbleibt, weil er mal eine deftige Packung bezieht, gehört vielleicht doch nicht zu denen, auf die es später ankommt.
Nicht wenige, vor allem Jungs, wollen sich an Schwierigkeiten und Stärkeren messen, Hierarchien auskämpfen oder Hackordnungen in Frage stellen. Ich erinnere mich noch lebhaft, dass wir mit unserer Dorf-Schülermannschaft gegen das übermächtige Haßloch stets Gefahr liefen, zweistellig abgewatscht zu werden. Dennoch fieberten wir diesen Herausforderungen entgegen, um eben das mit aller Macht zu verhindern. Und manchmal hatten wir zumindest Teilerfolge. Noch heute schwelge ich in selbstironischem Stolz über meine zwei Tore, die dafür sorgten, dass unsere 2:7-Schlappe glimpflicher ausfiel.
Demgegenüber kursiert aktuell das utopische Narrativ, man könne seine Leistung steigern ohne vermehrte Anstrengung und der trotzigen Verarbeitung von Misserfolgen. Nur so aber vollzieht sich Charakterbildung, zu deren Stärkung sich auch Praktiker wie Thomas Helmer, Ralf Rangnick, Rudi Völler, Berti Vogts oder Steffen Baumgart reformkritisch äußerten. Letzterer urteilte: „Wir sind eine Generation, die nur noch den weichen und seichten Weg geht. Es ist doch nicht schlimm, wenn ein Kind verliert. Es muss doch lernen, mit Niederlagen umzugehen.“
Im gehätschelten Mentalitäts-Trend liegt jedoch eher die total nivellierte Spaßgesellschaft, in der Jugendliche inflationär mit Medaillen und Ehrenurkunden überschüttet werden, die bei Turnieren und Spielfesten schon für bloße Teilnahme ausgehändigt werden. Ausdrücklich auf Anweisung des DFB, um die Jüngsten zu ködern. Beobachtet habe ich, dass man Acht- bis Zehnjährigen pro Trainingseinheit Gummibärchen applizierte, als ob unsere Jugend unterzuckert wäre. Und im Sommer wurden sie spätestens alle 20 Minuten kollektiv zur Tränke ihrer Wasserflaschen geführt. Alleingelassen wären sie sonst wohl verdurstet oder Hitzschlägen erlegen.
Genug davon. Beim Überlesen meiner Glosse frage ich mich jedoch kurz, ob ihr obiger Titel nicht vielleicht für politisierte Richter Verfängliches birgt. Dann beruhige ich mich wieder: Ohne Deutschlandbezug ist hierzulande wenig strafbar.
Unterstützen Sie Publico
Publico ist werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Mit Ihrem Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Danke!
Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl auf ein Konto überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punkt Über.










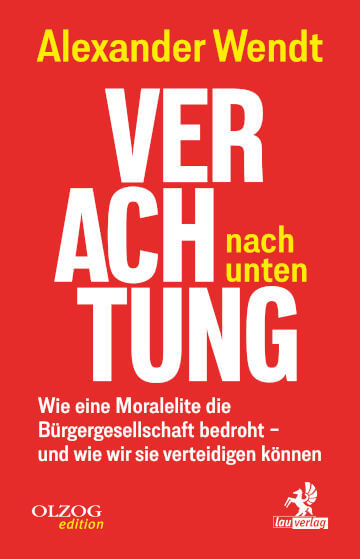

Roy
28. Juni, 2024„Der Filmemacher und #AllesDichtMachen-Unruhestifter Dietrich Brüggemann hat einen bösen Roman geschrieben: Wie viel Geschwurbel steckt in ‚Materialermüdung‘?“
Das hat die SZ tatsächlich geschrieben, hab’s nachprüfen müssen.