Identitätspolitik und sensible Kommunikation sollen die Welt retten. Dafür muss auch die Sprachlogik schwere Opfer bringen. Ein kurzer Abriss der Gendersprach-Geschichte
von Jürgen Schmid
Eigentlich ist zur Gendersprache alles Grundsätzliche gesagt. Aber unter den Entwürfen der Sprachingenieure gibt es immer neue Entwicklungsschübe, die es selbst den überzeugtesten Gerechtsprechern schwer machen, noch den Überblick zu behalten.
Die Geschichte der gendersensiblen Begriffsrevolution ist noch nicht ganz geschrieben, und vermutlich kommt sie wie die Neusprache selbst nie zum Ende. Bevor es um tote Radfahrende und verhinderte Wählende geht, braucht das Publikum deshalb wie bei TV-Endlosserien den nötigen Überblick: Was bisher geschah.
Im Zettelkasten des Autors findet sich als frühester Beleg ein „Rundschreiben über die Gleichbehandlung von Frauen und Männern im Sprachgebrauch der Berliner Verwaltung“ – erschienen im „Dienstblatt des Senats in Berlin vom 1. April 1987.“
In dieser Pionierzeit wurde vor allem mit dem Großen Binnen-I experimentiert – erstmals zogen StudentInnen in die Universitäten ein. Offensichtliche Unsinnigkeiten wie der Dienstrang „Amtmann“ für eine Frau, die auch kein „Kaufmann“ sein kann, wurden zu Recht beseitigt.
Zunächst waren es emanzipatorisch vorpreschende Frauen, die sich bemerkbar machen wollten – denn es ging stets um ’Sichtbarmachung‘. Und für den Anfang um zwei Geschlechter.
Im Jahr 1993 pochte die Deutsche UNESCO-Kommission in ihren „Richtlinien für einen nichtsexistischen Sprachgebrauch“ auf „Eine Sprache für beide Geschlechter“. Heute würden die Autorinnen Marlis Hellinger und Christine Bierbach im woken Milieu einen Sturm der Empörung auslösen ob ihres Verrats an der „Vielfalt der Geschlechter“. Damals galt ihr Entwurf als State of the Art in progressiven Kreisen.
Munter zweigeschlechtlich ging es dann weiter durch die Neunziger, angetrieben durch Frauenministerinnen, Gleichstellungskommissionen, Frauenbüros in diversen Verwaltungen, Universitätsfrauenbeauftragte.
Der Feminismus in seiner gendersprachlichen Ausprägung kann als Urmutter der Identitätspolitik gelten, die Dekolonisations-Bewegung als Urvater. Spätestens, seit Aktivisten der Decolonials die Wirkmächtigkeit von Sprache für ihre politische Agenda entdeckten und 2011 „Ein kritisches Nachschlagewerk“ namens „Wie Rassismus aus Wörtern spricht. (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutsche Sprache“ in die politische Kampfarena brachten, ging es dann nicht mehr nur um Frau-Mann-Gleichstellung. Sondern um die gesamte Gesellschaft, die dringend umgepflügt werden musste.
Diesen erweiterten Sprachgestaltungsanspruch atmet das Praxis-Handbuch der Hochschule Fulda – Titel „Gender und Diversität“ – ebenso wie sensible Sprachanweisungen für die sächsischen Universitäten: „Ausgesprochen vielfältig: Gender- und Diversitysensible Kommunikation“.
Mit immer neuen „Wörterverzeichnissen“ tun sich die „Neuen Deutschen Medienmacher*innen“ hervor, zuletzt 2020 mit „Formulierungshilfen und alternativen Begriffen für die Berichterstattung in der Einwanderungsgesellschaft“.
Betreutes Schreiben fällt damit sehr viel leichter, was schnell auch zum betreuten Denken führt.
Irgendwann schloss der Sensibilitätsanspruch dann alles und jeden ein, etwa der „Leitfaden für einen nicht-diskriminierenden Sprachgebrauch in Bezug auf junge und alte Menschen, Menschen mit Behinderung, Frauen / Männer, Schwule / Lesben / Transgender, Migrant/innen und Menschen mit einer anderen religiösen Zugehörigkeit“, den 2008 das österreichische Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit ersann.
Bald legte fast jede Organisation mit Gesellschaftsveränderungszielen einen Wunschkatalog zur Verbesserung unserer Sprache vor, beispielweise die „Nationale Armutskonferenz“ mit ihrer „Liste der sozialen Unwörter“. „Alleinerziehend“, hieß es dort, sollte nicht mehr verwendet werden, denn es „sagt nichts über mangelnde soziale Einbettung oder gar Erziehungsqualität aus; beides wird jedoch häufig mit ‚alleinerziehend’ assoziiert“.
2017 nahm sich endlich auch der Duden des drängendsten Problems unserer Zeit an: „DUDEN – Richtig gendern. Wie Sie angemessen und verständlich schreiben“. Und schon gab es Streit unter den Erwachten: Ein wohlwollender Rezensent musste den „Vorwurf von radikalfeministischer Seite, man [also Frau Diewald und Frau Steinhauer, die Autorinnen] habe ’nichtbinäre Menschen’ nur unzureichend gewürdigt“, zurückweisen. „Denn sehr praxisnah geht der Ratgeber davon aus, dass ’gendergerechte Sprache die Berücksichtigung von zwei Geschlechtern, Männern und Frauen, sicherstellen’ müsse, was sich unter anderem ’aus der prototypischen Alltagswahrnehmung vieler Menschen’ speise“.
Welche „Geschlechtsidentitäten“ unter „nicht-binär“ verstanden werden, zeigen exemplarisch die Einträge zur „Identität“ „genderfluid“ auf einschlägigen Homepages:
„Das Geschlecht kann sich manchmal ändern oder sehr oft oder nur selten. Bei manchen Menschen ändert es sich mehrmals am Tag, bei anderen alle paar Wochen, wieder bei anderen alle paar Jahre.“
„Manche genderfluide Personen fühlen sich die meiste Zeit über neutrois und an ein paar Tagen im Jahr ganz eindeutig weiblich, etc. Für viele genderfluide Personen ist es wichtig, dass ihr Ausdrucksgeschlecht und die für sie verwendeten Begriffe (wie ‚er’ oder ‚Frau’) jeweils zur aktuellen Geschlechtsidentität passen. Manche genderfluide Personen haben verschiedene Namen, mit denen sie je nach aktueller Geschlechtsidentität angesprochen werden.“
Dieses tagesaktuelle Geschlechtsgeschehen konnte hierzulande schon unschöne Affären auslösen, wenn selbst dem sensibelsten Bundespräsidenten, den wir jemals hatten, der üble Fauxpas des Missgenderns nachgewiesen werden konnte.
So kam schließlich der Gender-Stern in eine Welt, die neben Mann und Frau auch „diverse“ Geschlechter kennt – das sich ausbreitende Sternchen soll mit seinen vielen Strahlen diese Vielfalt symbolisieren.
Als in der Frankfurter Allgemeine Zeitung noch nicht jede progressive Neuerung begrüßt wurde, bekrittelte dort Andreas Kilb „den deutschen Amtsschimmel“, „der immer wieder verwüstend über die blühenden Wiesen tobt. Seine jüngste Maßnahme zur Planierung des Sprachgebrauchs sind die politisch korrekten Gender-Sternchen, die der Berliner Senat bei offiziellen Schriftstücken sogar zur Norm erklärt hat: Dort gibt es jetzt nur noch Bürger*innen, Bäcker*innen und Bäcker*innenbeauftragte, bloß die jugendlichen Intensivtäter sind weiterhin männlich.“
Abseits des Sterns hantieren Gendersensible mit allerhand Folterwerkzeug, um Sprache und Schriftbild zu malträtieren: Mit merkwürdigen Doppelpunkten in Wörtern – was Fjodor Dostojewski die Ehre beschert, „einer [sic] der einflussreichsten Autor:innen der Weltliteratur“ zu sein. (3sat)
Oder mit dem „Gender Gap“, welcher als „Unterstrich“ „eine Lücke zwischen Männern und Frauen [schafft] und damit Raum für die Vielfalt der Geschlechter“. Terroristen zündeln viel sensibler, wenn die klimabewegte „Vulkangruppe“ „Pendler_innen auf dem Weg zur Arbeit“ „ausbremst“. An der Humboldt-Universität zu Berlin (und nur dort, im Epizentrum der Wokeness) kann die Lücke sogar „wandern“.
Schließlich will die Süddeutsche Zeitung „den glottalen Plosiv markieren“: „Künstlerïnnen. Redakteurïnnen. Seglerïnnen.“ „Was für eine Zukunft wäre das, in der deutsche Wörter so aussehen könnten?“
Würde man die Geschichte der Gendersprache graphisch darstellen, sähe man auf der X-Achse in den 1990er Jahren langsam eine Nulllinie sich erheben, die sich zu einem Gebirge auffaltet, aus dem jetzt, 2021,die ersten Achttausender herausragen. Mittlerweile ließen sich mit „Leitfäden“, „Glossaren“, „Handreichungen“, „Nachschlagewerken“, „Formulierungshilfen“, „Checklisten“, „Tipps“, „Empfehlungen“ für „Sprachgebräuche“ oder „Sprachhandlungen“ und „Lebensratgebern“ ganze Bibliotheken bestücken.
„Manierierte Sprachcodes“ und „progressives Wortdesign“ der Wokisten führen sogar zu größeren Rissen que(e)r durch das progressive Milieu, etwa, wenn linke Publizisten wie die „Ruhrbarone“ den Genossinnen von den „Neuen Deutschen Medienmachern“ Sabotage vorwerfen, weil diese im „Wettlauf um die neuesten Nichtdiskriminierungs-Trends“ „Aufklärung mit Belehrung [verwechseln] und ein Klima des Misstrauens“ erzeugen würden.
Wie reagiert nun ein Autor wie der Verfasser dieses Wörterbuchs auf diese Entwicklung, neben der die Geschichte des Kirchenlateins eher übersichtlich wirkt? Neulich schrieb mir ein Freund, Sprachkritisches zu verfassen wäre wichtig – mit der Ergänzung: „nicht zuletzt für den Lesenden!“ Darauf musste ich antworten: Ich schreibe ausschließlich für Leser. Für Lesende kann ich schlecht schreiben, weil die mir beim Schreibvorgang über die Schulter schauen müssten.
Das ist das Funktionsprinzip des Partizip Präsens Aktiv (Lateinern bekannt als PPA) – anzuzeigen, „dass eine bestimmte Tätigkeit gleichzeitig zum Prädikat des dazugehörigen Satzes stattfindet, unabhängig vom Tempus, in dem dieses steht“.
Um es mit dem Germanisten Paul Pfeffer zu sagen: „Leser“ bezeichnet einen Status, „lesend“ eine Tätigkeit.
„Bei ‚Absolventen’“, so Gender-Kritiker Pfeffer, „wird das Problem besonders deutlich. Das haben auch die Sprachaktivistinnen gemerkt und in ihren Gender-Ratgebern nicht etwa ’Absolvierende’ vorgeschlagen, was offensichtlicher Unsinn gewesen wäre, sondern ’einen Abschluss innehabende Personen’. Konsequenterweise hätten die Studenten statt ’Studierende’ dann in ’an einer Universität immatrikulierte Personen’ umbenannt werden müssen. Das wäre zwar korrekt, aber kein Gewinn für die deutsche Sprache.“ Ebenso wäre es sprachlich richtig, zukünftige Leser eines im Entstehen begriffenen Textes als „Lesenwerdende“ zu bezeichnen, was allerdings dem Feingefühl des Autors und seiner Leser zuwider laufen würde.
Womit wir bei der neuesten Entwicklungsstufe wären: Der Partizipkonstruktion, die alles gerecht einschließen soll.
„Wir wollen keine toten Radfahrenden in der Stadt“, heißt es beispielsweise beim NDR über Hamburg. Ganz nebenbei: Wer will die überhaupt?

Dazu passend fragte übrigens die Vorsitzende der österreichischen Sozialdemokraten Pamela Rendi-Wagner: „Wie viele Tote müssen noch sterben?“
In Berlin beklagte die Landeswahlleiterin vor dem Abgeordnetenhaus laut Protokoll: „In einzelnen Wahllokalen weichen die Zahlen jedoch ab, z.B. weil Wählende […] Stimmzettel nicht eingeworfen haben“. Der Wählende, der wegen Organisationspannen den Stimmzettel nicht einwirft, ist immerhin die kongeniale Berliner Entsprechung zum toten Radfahrenden in Hamburg.
Der Sprachwissenschaftler Peter Eisenberg schreibt über den Furor der woken Sprachvervielfältigung: „Statt zu akzeptieren, dass unsere Sprache alles hat, was man zur Vermeidung von Diskriminierung durch das Geschlecht braucht, wird von Ideolog*innen in Machtposition ein Stellvertreterkrieg entfacht, der die Sprache verhunzt.“
Wenn Eisenbergs Kollege Jürgen Trabant feststellt: „Sprechen besagt: Einer teilt dem anderen mittels Lauten etwas über die Welt mit“, dann wird deutlich, was die Verfechter der sensibilisierenden Sprachoperation tun: Sie teilen der Welt etwas über ihre Scholastik mit. Und bei bestimmten Operationen ist es eben geradezu zwingend, dass der Patient sie nicht überlebt – in diesem Fall die Sprachlogik.
Die verstorbenen Radfahrenden des NDR könnte eigentlich nur der Doktor der Physik Erwin Schrödinger angemessen behandeln, wenn der nicht selbst schon ganz zweifellos tot wäre. Was schade ist. Denn als Spezialist für alles, das irgendwie lebt, aber gleichzeitig auch perdu ist, wäre er der Richtige, um sich der Gendersprache als Ganzes anzunehmen.
Jürgen Schmid ist Historiker und freier Autor. Er lebt in München.
Unterstützen Sie Publico
Publico ist weitgehend werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Im Gegensatz zu anderen Medien finanziert sich Publico weder durch staatliches Geld noch Gebühren – sondern nur durch die Unterstützung seiner wachsenden Leserschaft. Durch Ihren Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Vielen Dank im Voraus!
Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl via Paypal oder auf das Konto unter dem Betreff „Unterstützung Publico“ überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punk Über.


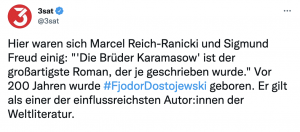


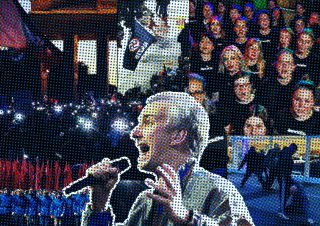


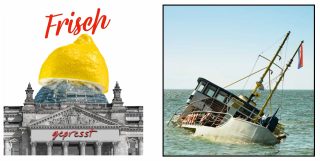



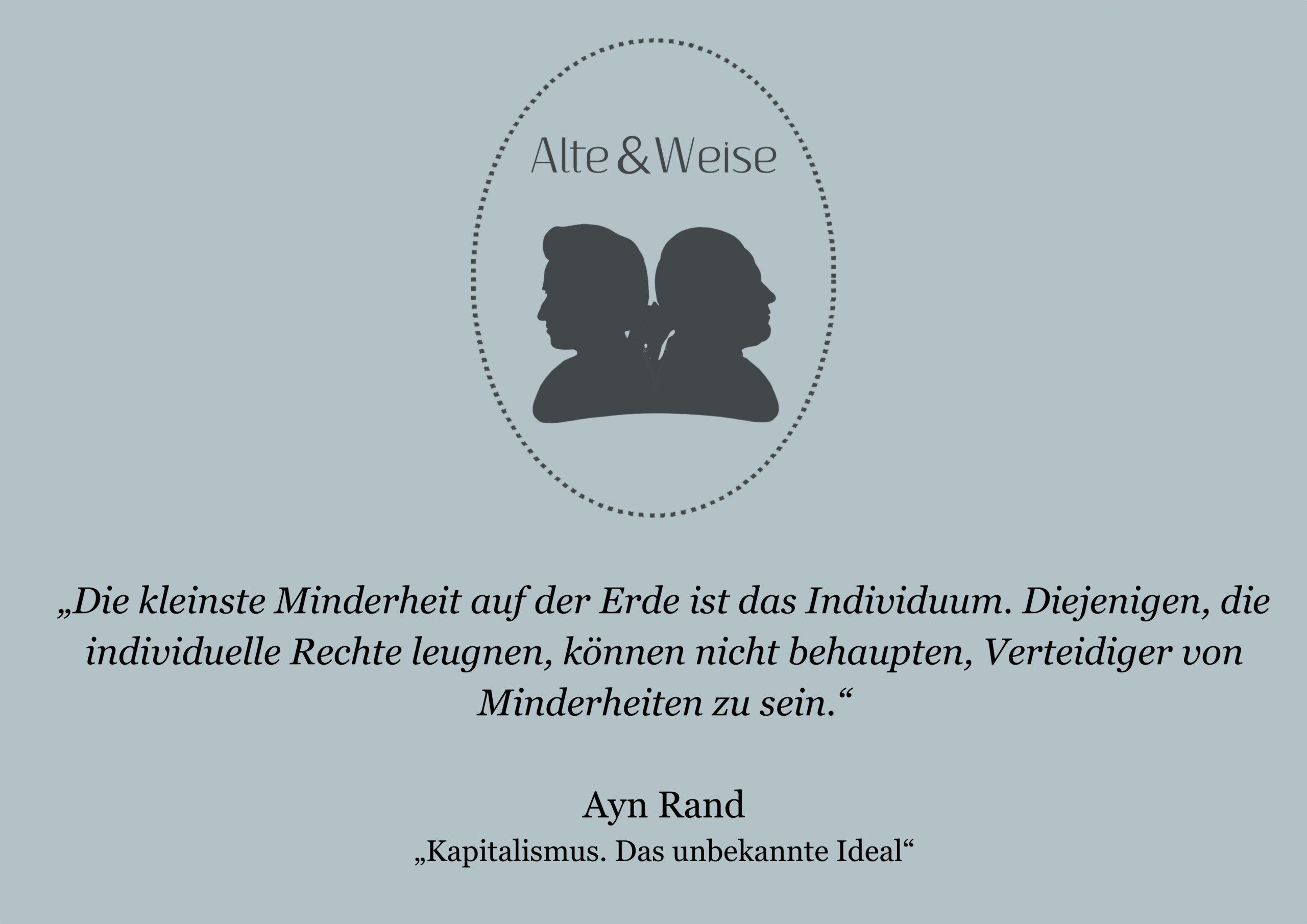
TinaTobel
23.11.2021These:
Würde die Genderei ihren Propagandistinnen nicht Einkommen, Renommee und Macht verschaffen, gäbe es sie nicht.
Jens Richter
26.11.2021Wenn ein Stromausfall länger als eine Woche dauert, wird nicht mehr gegendert, dann platzt die Gehirnblase der Überverwöhnten. Die Sprache wird dann schnell maskulinisiert, und das Gekreische nach dem nicht nur generisch maskulinen Elektriker, dem Fachmann, der schnell den Zugang zu Facebook und Twitter wieder herstellt, wird nicht aufhören, und das Gendervolk wird herbeiströmen und vor den Steckdosen knien und beten.
Andreas Stüve
23.11.2021Damit sich mein Geschlecht nicht stündlich ändert, gelobe ich vor dem Heiligen Genderissimus die Liste der Unwoerter auswendig zu lernen und den Inhalt künftig täglich zu rezitieren. Auch wenn ich dafür von Radfahrenden, Dummschwaetzenden und Indoktrinierenden kritisiert werde. Es leben die Schillernden, Bunten und Queerenden.
Albert Schultheis
23.11.2021Wie wäre es, wenn wir diesen glottal stoppisch gackernden Hühner*Innen sagten, „Sie können auch einfach Deutsch mit mir reden.“
Immo Sennewald
23.11.2021Die von moralischem Furor getriebenen „Besser-Sprechenden und -Schreibenden“ werden gewiss nicht verstehen, welches Vergnügen ihre Stilblüten auslösen, die massenhaft zu Witzen und Pointen führen. Der Gymnasialprofessor Galetti erntete vor 200 Jahren dadurch einigen Ruhm, allerdings bin ich nicht sicher, ob er’s nicht heimlich darauf angelegt hatte. Ihre komische Wirkung ist immerhin noch nachzulesen. Vielleicht schafft’s das Gendern auf diese Weise auch zu überleben. https://www.aphorismen.de/suche?f_autor=8104_Johann+Georg+August+Galletti
A. Iehsenhain
23.11.2021Grandiose Analyse, Herr Schmid! „Tote Radfahrende“ sind wohl eher ein Fall für Spiritisten oder Parapsychologen, und nimmt man Frau Rendi-Wagner wörtlich, zählt mittlerweile der Scheintod ebenfalls zu den Symptomen einer Corona-Erkrankung. Eine gewisse Antje „Lann“ Hornscheidt bezeichnet sich selbst als „Profex Drex“ (Prof. Dr.) und ist „auf dem Gebiet der Sprachwissenschaft und Skandinavistik sowie der Gender Studies tätig“ (laut Wikipedia), dem selbstgewählten Akademikerkürzel nach aber wohl eher als satirische Alleinunterhalterin bei den Eisbären. Der Glottisschlag beim Gendern erinnert mich an einen Schluckauf; vielleicht kann man ja durch Eingriffe am Kehlkopf den Geschlechterunterschied noch einmal auch besonders für den Sprecher optimieren, indem man die Stimmbänder in verschiedenen Geschmacksrichtungen modifiziert – dann schmeckt die eine Hälfte des Gaumenzäpfchens z. B. nach Hugo und gemischtem Salat mit Putenstreifen, und die andere nach sauren Kutteln mit Bratkartoffeln und dazu ein Pils. Welchem Geschlecht man das dann zuordnet, bildet schon wieder den willkommenen Rahmen für neue sinnentleerte Streitgespräche…
Martin
24.11.2021Ich will auch keine toten Radfahrenden in der Stadt, die stinken doch. Und dann, das dauernde „Brains! Brains!“ wenn sie an einem vorbeistrampeln. Obwohl…. rücksichtsloser und dummdreister als manche von ihrem Gutmenschentum überzeugten Grünradler:innen könnten echte radfahrende Untoten und Untotinnen auch nicht sein.
pantau
24.11.2021Ich interpretiere das Gendern als Symptom für die allgemeine Tendenz zur systematischen Verkehrung, geradezu einem Kult und formalen Bedürfnis, alles auf den Kopf zu stellen. Wichtig und Unwichtig. Wesentlich und Unwesentlich. Deutlich und Undeutlich, Ausnahme und Regel. Dann treten primitivere Ordnungskriterien in den Vordergrund, etwa ideologische Zugehörigkeit, Rudeldenken usw. Im Extrem wird dann eine Vergewaltigung, wenn der Täter zur ideologisch aufgewerteten Klientel gehört, zu einem kulturellen Mißverständnis planiert und eine doppeldeutige Flirterei zu einem Kapitalverbrechen u. Hatecrime. Ich ordne auch das platzgreifende systematische Verwechseln der logischen Partikel „den – denn“ und „das – dass“ unter diese allumfassende formale Verkehrung und Inversion . Schlimm auch, wenn sogar in genderkritischen Medien (gottlob noch nicht hier) von „Regierenden“ die Rede bzw Schreibe ist. Die Macht der Gewohnheit. Vielen Dank für diesen informativen und elegant geschriebenen Text.
Thomas
27.11.2021Tote Radfahrende und geschätzte Wählende.
Berliner Republik. Die Roths, Grüns und Bunts sind an der Macht. RAFD. AfDDR. Und das eben auf ihre Weise, so daß es im Grundgesetz nur so raucht. Au weia.
Dr. Stephan Bachter
28.11.2021Kollege Jürgen Schmid meint in seinem jüngsten Beitrag von einem „Freund“ berichten zu müssen, der ihm schrieb, Sprachkritisches zu verfassen wäre wichtig – mit der Ergänzung: „nicht zuletzt für den Lesenden!“. Diese Verwendung des PPA (Partizip Präsens Aktiv) meint Schmidt kritisieren und in seine Philippika gegen sprachlichen Genderwahn einsortieren zu müssen. Ich möchte ihm (dieser Freund seiend) antworten: Obacht, Jürgen, ganz so einfach ist es nicht. Zum einen halte ich den Ausdruck „Lesende“ für korrekt, so wie von mir ursprünglich verwendet, nämlich am Ende eines ins Futur gesetzten Satzes und damit gemeint: Die zukünftig aus der Schmidt’schen Feder Sprachkritisches Lesenden. Aber verhält es sich mit dem PPA tatsächlich so dogmatisch, wie Schmidt mit seiner Paraphrasie des Wikipedia-Artikels zur Verwendung des PPA im Lateinischen suggerieren möchte? Jürgen Schmidt gibt dazu wieder: „Das ist das Funktionsprinzip des Partizip Präsens Aktiv (Lateinern bekannt als PPA) – anzuzeigen, „dass eine bestimmte Tätigkeit gleichzeitig zum Prädikat des dazugehörigen Satzes stattfindet, unabhängig vom Tempus, in dem dieses steht“.
Ein doch herausragender Poet deutscher Sprache, Rainer Maria Rilke, verfasste zwei Gedichte, eines tituliert „Der Lesende“, das andere „Der Leser“. Das Poem „Der Lesende“ beginnt mit „Ich las schon lang. Seit dieser Nachmittag/ mit Regen rauschend, an den Fenstern lag“. Hier gibt es keine gleichzeitigen Tätigkeiten mit dem Prädikat des dazugehörigen Satzes. Der, die, das, Subjekt des Gedichts, liest einfach nur. Er ist in diesem Moment Lesender und Leser gleichzeitig. Genauso wie das Subjekt von Rilkes anderem Gedicht „Der Leser“, das als in ein Buch vertieft beschrieben wird, also ebenfalls Leser und Lesender gleichzeitig ist.
Ich würde dazu raten, nicht jede vom Lateinischen mitunter abweichende Verwendung des PPA im Deutschen reflexhaft mit „Genderwahn“ und „Sprachdiktat“ in Verbindung zu bringen. A bisserl mehr Gelassenheit, nicht bei jedem PPA über’s Stöckerl springen und nicht ständig in bester antimoderner und traditionalistischer Manier in politisch korrekte Schnappatmung und dogmatischen Elitendünkel zu verfallen.
Thomas
29.11.2021Text
Ein kurzer Abriss der Gendersprach-Geschichte. Wer liest, der tut das auf eigene Gefahr. In „Schmids Wörterbuch“ notiert der Historiker Jürgen Schmid seine kritischen Beobachtungen zur Medien-, Werbe- und Alltagssprache. Gut so!
Bravo.
• *Der Wählende, der wegen Organisationspannen den Stimmzettel nicht einwirft, ist immerhin die kongeniale Berliner Entsprechung zum toten Radfahrenden in Hamburg.* (Schmid, siehe oben)
Das stimmt.
Wer in der Öffentlichkeit Kegel schiebt, muß sich von jedem sagen lassen, wieviel Punkte er geworfen hat – darüber ist nicht zu reden. Wenn aber zwei Elemente zusammenstoßen, so ist der Klang, den das gibt, ein Produkt beider. Beider! Leider setzen sich schreibende oder kommentierende Personen heute sehr oft darüber hinweg, daß tote Radfahrende in Hamburg oder das bis zur Hälfte Gelesene etwas mit dem Text, dem Schreibenden und dem Lesenden gleichzeitig zu tun hat. Wobei in diesem Bereich selbst Unfug manchmal lesenswert ist:
1. „A bisserl mehr Gelassenheit, nicht bei jedem PPA über’s Stöckerl springen und nicht ständig in bester antimoderner und traditionalistischer Manier in politisch korrekte Schnappatmung und dogmatischen Elitendünkel zu verfallen.“
2. „Diese Verwendung des PPA (Partizip Präsens Aktiv) meint Schmidt kritisieren und in seine Philippika gegen sprachlichen Genderwahn einsortieren zu müssen.“
Zur Information: Eine Philippika ist eine leidenschaftliche, heftige Straf-, Angriffs-, Brand- oder Kampfrede.
https://de.wikipedia.org/wiki/Philippika
Wahr ist, daß sich der obige Text „Tote Radfahrende“ des Herrn Schmid die Mittel und Methoden jener Identitätspolitik und sensible Kommunikation zur Brust nimmt, die wohl die Welt vor falscher Sprache retten sollen und bei der Sprachlogik schwere Opfer in Kauf nehmen, wobei der Herr Schmid (durchaus bescheiden) ausdrücklich bekennt, nur einen kurzen Abriss der Gendersprach-Geschichte verfasst zu haben. Natürlich ist in diesem Text weder von einem „Genderwahn“ die Rede noch verfällt er „ständig in bester antimoderner und traditionalistischer Manier in politisch korrekte Schnappatmung und dogmatischen Elitendünkel“. Was ist da also passiert: Nun,
da verfasst also auf den Text des Herrn Schmid hin wer einen Kommentar und erzählt etwas von einer „Philippika“, was erstmal neugierig macht, woran diese „Straf-, Angriffs-, Brand- oder Kampfrede“ denn nun zu erkennen sei – und da werde ich angesichts der vielversprechenden und mutigen Diagnose „Philippika“ doch sehr schwer enttäuscht. Wo verbirgt sich diese also. Denn schließlich ist so ein Text bekanntlich kommunikative Handlung. Verstümmelter Satz, verstümmelte Nachricht. Wer dann als Lesender und Schreibender in einer Person aus dem obigen Text eine „Philippika“ bastelt und dem Autor gleichzeitig eine „Gelassenheit „ans Herz legt, der hat wohl seine eigenen Gründe. Diese sind dann aber wohl eher nicht von allgemeinem Interesse. Nach meinem Dafürhalten handelt es sich dabei dann eher um einen jener Stöckchenspringenden, der einem Gegenüber wegen dessen Text als Stöckchenspringer „kritisiert“. Derlei kann man sehr oft bei Aktivisten in den Gerechtigkeitsdebatten betrachten, wenn es etwa um Klima, Geschlechter, Reichtum, Armut, Gesundheit oder Menschheit geht. Meist werden sie dort von so genannten „Moderatoren“ als „Experten“ vorgestellt. Jenes Verhalten in modernen Debatten, bei dem einem Gegenüber haargenau jenes Fehlverhalten unterstellt wird, welches „Kritisierende“ in ihrer Argumentation stirnrunzelnd selber praktizieren (beispielweise, wenn sie auf rüde Weise „Respekt“ oder „Toleranz“ einfordern). Derlei ist bei so genannten „Kritikern“ ungemein modern. So wird die Tendenz der eigenen Argumentation verdeckt und die unangenehme Argumentation eines Gegenüber elegant umgangen. Schwupp.
Im Gegensatz zum obigen Text des Herrn Schmid, in dem dieser durchweg sachlich von der Gendersprache mit ihrer gendersensiblen Begriffsrevolution spricht, basteln gewisse „Freunde“ daraus dann prompt eine „Philippika“ gegen „Genderwahn“ und „Sprachdiktat“ und begehen damit reinstes Begriffsfluid, das sich heute leider längst bereits in politischen Lehrbüchern breit macht, in Radio, Funk und Fernsehen. Beitragsfinanziert. Verstümmelter Satz, verstümmelte Nachricht.
Diese Strategie kann man sehr schön am Beispiel „Gedankenaustausch“ beleuchten: Das Genus bildende Grundwort dieses Kompositums ist „Austausch“. Ersetzt man nun das Bestimmungswort „Gedanken“ durch ein beliebiges anderes Substantiv, zum Beispiel „Körperflüssigkeiten“, so wird beim aufmerksam Lesenden sofort deutlich (sofern derjenige dazu in der Lage ist), daß die Angelegenheit des Austausches per se nur in den seltensten Fällen willkürlich willkommen ist. Im Gegensatz zum Austausch von Körperflüssigkeiten (den man in der Regel physisch abwehren kann), ist man gegen den verlautbarten fremden Gedanken (als Produkt eines fremden Denkprozesses) nur dann weitestgehend geschützt, wenn die eigene prozessuale Leistungsfähigkeit stark eingeschränkt ist. Klassisch wäre dies bei einer Ohnmacht der Fall. Wohingegen Schwachsinn einen eventuell empfangenen Schwachsinn ohne weiteres verstärken kann. Ob eine Darbietung in Form eines Textes dann geschmackvoll oder geschmacklos ist, angenehm, anziehend oder abstoßend wirkt, ob sie absichtlich oder unabsichtlich Richtiges oder Falsches enthält, Information oder Manipulation, nun,
da kann jeder Erwachsene das Dargebotenen entweder annehmen oder es ablehnen, es betrachten oder ignorieren. Leider hat sich im Internet und anderswo aber eine Sorte Leute breitgemacht, die absichtlich auf Meinungs-, Nachrichten-, Porno-, Amts-, Gewerbe- oder Privatseiten gehen und sich dann über das Dargebotene mächtig aufregen
– und als Krönung darüber hinaus schieben diese Leute dem Dargebotenen mit ihrer „Kritik“ noch etwas unter, das ihr eigener Text durch Manipulation des Gesagten oder Gezeigten erst fabriziert hat. Da schießen dann „Genderwahn“, „Schnappatmung“, „Dogmatik“ oder „Elitendünkel“ wie halluzinogene Pilze aus einem stolz gepflügten Boden. Gewisse Leute tun dann so, als sei ihnen eine andere Sicht auf die Gendersprache geradezu aufgenötigt worden, die besser unterblieben wäre.
Das würde diesen Leuten („Experten“) so passen.
3. „Die zukünftig aus der Schmidt’schen Feder Sprachkritisches Lesenden.“
Ich bin so einer. Und wer aus den oben niedergeschriebenen Gedanken zur Gendersprach-Geschichte des Herrn Schmid eine „Philippika“ gegen „Genderwahn“ und „Sprachdiktat“ herausliest, der sagt damit leider mehr über sich selbst aus, als über den Text. Das nur zur Einordnung.
4. „Ich möchte ihm (dieser Freund seiend) antworten: Obacht, Jürgen, ganz so einfach ist es nicht.“
Nein, so einfach ist es wirklich nicht. Das stimmt. Immerhin wird hier der Vorname richtig geschrieben. Immerhin. Man wird ja so bescheiden. Übrigens sind auch Danaer im Grunde „Schenkende“;
Freund sind sie deswegen noch lange nicht. Nun ja, das geht mich zum Glück nichts an.
• „Das Wort muss Mensch werden. Das ist das Geheimnis der Welt!“
(Rainer Maria Rilke, 1904)
So einfach, und doch so schwer.
Werner Bläser
29.11.2021Das ganze Gegendere scheint im Kern auf die alte ‚Humboldt-Sapir-Whorf-These‘ zurückzugehen (mit einem Schuss Gramsci), wonach Sprache das Denken beeinflusst (mal ganz simpel gesagt). Daran ist teilweise etwas Wahres.
Verschiedene nordamerikanische Indianerstämme, die Europäern gegenüber eine eingeschränkte Farbwortpalette haben, haben auch Probleme, die in ihrer Sprache nicht vorhandenen Farben voneinander zu unterscheiden. Sie sind das schlicht nicht gewohnt. Allerdings lässt sich das Unterscheiden für diese Probanden, Zunis und Navajos, meiner Erinnerung nach, sehr leicht in kurzer Zeit erlernen.
Beliebt als Beispiel für die Entsprechung Sprache-Denken, oder Sprache-Kultur, ist das Beispiel der Eskimos (ich entschuldige mich: Inuit natürlich), wonach diese im Schnee lebenden Menschen sehr viele uns unbekannte Ausdrücke für verschiedene Schnee-Formen haben (Richard David Precht hat das einmal bestritten, aber der Fakt steht – Precht hat wohl mehr Ahnung von Philosophie als von Linguistik).
Sehr viel mehr empirische Hinweise auf einen engen Zusammenhang zwischen Sprache und Kultur sind mir nicht bekannt. Und vor allem gibt es auch Gegenbeispiele. Gleiche Kulturen unter den Indigenen im amerikanischen Nordwesten („Korbflechterkulturen“) haben teils völlig unterschiedlich entwickelte Ausdrucksvarietäten in ihren Sprachen, obwohl sich das kaum erklären lässt (so jedenfalls mein Wissensstand aufgrund meiner – zugegeben – SEHR weit zurückliegenden letzten Ethnolinguistikseminare).
Also was liegt näher, wenn man ein Revolutionär und moralischer Weltenbeglücker ist, als sich der Sprache zu bedienen, um Denken und Kultur zu verändern. Das hat ja schon gute linke Tradition in Deutschland und anderswo. Wenn man schon von physikalischen oder anderen Fakten wenig bis keine Ahnung hat – Intellektuelle können sich immer auf sprachliche Kniffe zurückziehen. Schon Stalin gab die Wortwahl für bestimmte Phänomene genau vor; „Internationalismus“ war gut – „Kosmopolitismus“ war schlecht, obwohl es augenscheinlich dasselbe bezeichnete, um nur ein Beispiel zu nennen.
Wobei natürlich im Ermessen des Sowjet-Herrschers lag, was jeweils was war (interessant dazu: die Diplomarbeit von Donara Stanculovic, Sprache und Macht unter Stalin, Wien 2012 – ich selbst habe einiges über die Stalin’schen Sprachregelungen in Vorlesungen des verehrungswürdigen Wolfgang Leonhard erfahren).
Unsere lieben Linken haben diese einfache pädagogische Massnahme aber noch weiter verfeinert. Erfahrung bildet ja schliesslich. Da die Setzung von politisch korrekten Sprachformeln auf Dauer nicht ausreicht, verfährt man einfach nach dem Prinzip der „Permanenten Sprach-Revolution“ (Trotzki würde sich im Grab kranklachen): Sobald eine sprachliche Vorschrift akzeptiert ist, muss die Vorherrschaft und Bedeutung der Sprach-Inquisition dadurch betont und aufgefrischt werden, indem sie einfach NEUE Regeln erfindet.
In den USA wechselte der Sprachgebrauch von „nigger“ zu „negro“ zu „black“ und neuerdings zu „people of colour“.
Wenn das einmal eingebürgert ist, wird man auch das als diskriminierend brandmarken und etwas Neues propagieren – denn so wenig wie Bürokratien ihre Aufgaben abschaffen, schaffen Linksintellektuelle ihre permanenten Ermahnungs- und Lenkungsrechte für die Gesellschaft ab.
Denn schliesslich geht es hier nicht um die Abschaffung von Diskriminierung – es geht um etwas viel Wichtigeres: um die Priesterherrschaft der Linksintellektuellen, wie sie Schelsky schon vor Jahrzehnten vorausschauend beschrieb.
Alexander Wolff
27.12.2021Der Verfasser irrt, wenn er meint, dass mit Kaufmännern und Hauptmännern und ähnlichen Amtsbezeichnungen die gröbsten Fehler früh beseitigt wurden. Das „mann“ in diesen Worten hat überhaupt keinen geschlechtsspezifischen Bezug, sondern kommt von „man“ gleich Mensch. Deshalb heisst der Plural auch „….leute“ und nicht „..männer“. Kaufleute und Hauptleute wissen das in der Regel.
Wunderbar auch die Abneigung gegen „minister“, dabei ist das die weibliche Form (auch). Minister mea ist „meine Dienerin“, also femininum.
Nur bei Hannover gebe ich mich geschlagen. Die Stadt Hannova hat die neue Schreibung mehr als verdient.