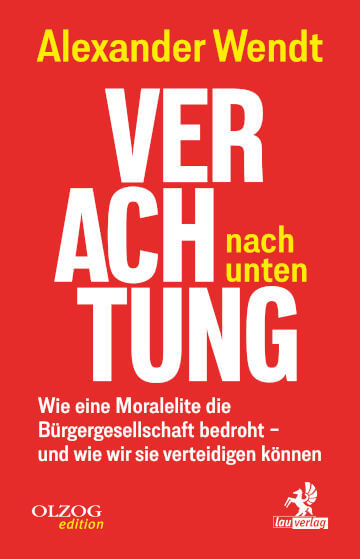Die Tage nach den Wahlen gehören für Politikwissenschaftler, Redaktionsmitglieder und andere Konsenshüter neuerdings zu den unangenehmsten überhaupt. Anders als die Politiker können sie schlecht sagen, sie müssten das Ergebnis jetzt erst einmal in den Gremien auswerten. Ihre Aufgabe besteht darin, sofort Gründe für den Wahlausgang zu finden, allerdings nur, falls die Wahlen in einer ganz bestimmten Weise ausgehen.
Aufessen, Fenster ankippen, richtig wählen – dann gibt’s auch mehr Eis
Was täten die Bürger eigentlich ohne den politischen Apparat? Auch wenn nicht gerade Abstimmungen drohen, bekommen die Menschen draußen im Lande laufend Verhaltenshinweise: eine kurze Rezension der bekanntesten Erziehungs- und Wahlplakate
Die dunkle Materie und der Fixstern Frank-Walter S.
Das „Wir“-Buch des Bundespräsidenten kann man nur als Ganzes wahrnehmen: als Dokument eines sehr speziellen, aber mächtigen Milieus. Zu anderen Zeiten wäre der Autor im Säurebad der Lächerlichkeit gelandet. Heute verformt er zusammen mit ähnlichen Figuren die Wirklichkeit
Voyeure der Gewalt
Unter westlichen Intellektuellen finden Täter der Hamas fanatische Unterstützer. Könnte es sein, dass die Rechtfertigung selbst extremer Gewalt nicht in erster Linie einer Ideologie entspringt, sondern einem bestimmten Persönlichkeitsmuster? Das würde die lange Beziehung zwischen Feinsinn und Blutbad besser erklären als der Blick auf Parolen und Ideen
Die schöne Mediengeschichte: kleine Räume für kleine Leute
Gesellschaftslenker in und außerhalb von Redaktionen wollen unbedingt die Frage diskutieren, wieviel Quadratmeter dem Einzelnen in Wirhabenplatzland zustehen. Denn hier gibt es sehr wohl Obergrenzen. Demnächst auch in anderen Privatangelegenheiten. Das neue Ideal heißt: Schrumpfbürger
In der neuen Publico-Serie „Die schöne Mediengeschichte“ sollen in lockerer Folge Texte und Dokumentationen über das Einordnungsschaffen in diesem Land erscheinen. Der erste Beitrag beschäftigt sich zum einen mit einem generellen Phänomen, nämlich dem Gleichtakt, mit dem Sender, Magazine und Zeitungen etwas zum gesellschaftlichen Gesprächsthema erklären, über das angeblich ganz Deutschland redet oder jetzt bitteschön reden muss.
Breaking Bad im Hörsaal: giftige Lehren für die Gesellschaft
Die Extremisten der Gegenwart arbeiten heute an den Universitäten – in Deutschland sogar mit Beamtenstatus. Sie bauen Hochschulen in Labore für Ideen zur Delegitimierung des Westens um. Noch wäre Zeit, dieses Treiben zu stoppen
In früheren Zeiten, als der Glaube an die Übersichtlichkeit noch geholfen hatte, richtete sich der Blick auf die Parteien und ihre Vertreter, wenn es darum ging, die Breite des politischen Spektrums abzuschätzen. Es gab Extremisten und Radikale an beiden Rändern, daraus ergab sich die ungefähre Mittelposition.